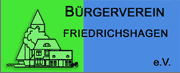Aus Thüringen zurück nach Friedrichshagen
Nicht in Friedrichshagen, auch nicht sonst irgendwo in Berlin, sondern in einem Dorf in Thüringen, in der Nähe von Gera, war es, wo Klaus D. das Kriegsende erlebte. Und es waren auch nicht sowjetische Soldaten, die er dort zu Gesicht bekam, sondern amerikanische. Es hatte seine Familie dorthin verschlagen, da dem Vater das Leben in Berlin aufgrund der zunehmenden Bombenangriffe zu gefährlich wurde. Sie fand Unterschlupf in einem Bauernhof. Die Bäuerin, deren Mann von der Wehrmacht eingezogen worden war, stellte der hilfesuchenden Familie ein kleines Zimmer zur Verfügung.
Klaus D. wurde dort noch eingeschult. Er kann sich noch erinnern, dass er eines Tages, als er offenbar noch unzureichend ausgeschlafen in die Schule kam, mit der Absolvierung des obligatorischen „Hitler-Grußes“ der Lehrerin nicht schnell genug war und deshalb sofort eine schallende Ohrfeige bekam.
Sein Vater vermied immer den Gebrauch des „Hitlergrußes“ sondern grüßte sein jeweiliges Gegenüber wie eh und je mit „Guten Tag“. Er musste während der Kriegszeit zeitweise untertauchen. Glücklicherweise war er nicht in den Krieg eingezogen worden, da er bei den Rekrutierungsbehörden für sich reklamiert hatte, dass er „Halbjude“* sei und daher „unwürdig“ für eine aktive Teilnahme am Krieg.
Als die amerikanischen Soldaten anrückten, verhinderte der örtliche Bürgermeister, dass – entgegen der Order – Waffen in die Hand genommen wurden und somit alles glimpflich ablief. Er habe auch noch eine „genaue Erinnerung“ an die Flugzeugstaffeln, die Richtung Osten flogen, und über die er später erfuhr, dass ihr Bombenziel Dresden war.
Nach einiger Zeit wurden die amerikanischen Soldaten durch sowjetische ersetzt. Diese seien zu den Kindern immer sehr nett gewesen. Sie hätten ihnen auch von ihrem eigenen Brot abgegeben.
Den Vater zog es wieder zurück in die alte Wohnung am Müggelseedamm. Nach Verhandlungen mit der sowjetischen Kommandatur bekam er, da er „Widerständler“ war, im Mai 1945 für seinen Umzug einen Eisenbahnwaggon zur Verfügung gestellt. Eine ganze Woche dauerte die Fahrt mit Kind und Kegel nach Friedrichshagen, für den kleinen Klaus und seinen noch etwas kleineren Bruder und der größeren Schwester eher mehr ein Abenteuer als eine Anstrengung.
Die Versorgung mit Lebensmittel „war knapp“, eine Scheibe Brot „war etwas Kostbares“, Grund-Lebensmittel wie Fett, Zucker, Brot waren rationiert, es gab, sozial gestaffelt, Lebensmittelkarten, und auch Kohlekarten. Solche Voraussetzungen erzeugen schnell einen Schwarzmarkt. Es wurde alles Erdenkliche getauscht, ein Zustand, der einige Jahre andauerte. Viele Berliner fuhren in oft „total überfüllten“ Zügen aufs Land, um bei Bauern Lebensmittel für Sachen, die sie mitgebracht hatten, einzutauschen. Dies nannte man „Hamstern“.
Not mache „erfinderisch“. Die Menschen seien solchermaßen gezwungen, mehr aufeinander zuzugehen. Den Einwand, es gäbe auch die Auffassung, dass eine solche Situation sich eher dahingehend entwickle, dass die Menschen mehr um ihren eigenen Vorteil bedacht seien, also egoistischer werden, lässt er nicht gelten. Er habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen dann die Einsicht entwickelten, dass es für sie alle leichter werde, wenn sie aufeinander zugehen. Es sei dies die Einsicht in ihre gemeinsame Not, verbunden mit dem Wunsch, die Not zu wenden – also ganz in der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs der „Notwendigkeit“.
Im Nachhinein hatte er den Eindruck, dass der überwiegende Teil der Friedrichshagener froh war, dass der Krieg zu Ende war und diesen Krieg auch als die Ursache ihres damaligen Leides sahen. Sein Vater unterschied in dieser Nachkriegszeit im Hinblick auf die NS-Vergangenheit zwischen „Mitläufer“ und „Denunzianten“. Denunziantentum hatte er sicherlich häufig am eigenen Leib erfahren müssen. Eine weitergehende Beschäftigung mit der Vergangenheit geschah in diesen Tagen seinem Eindruck zufolge nicht. Die Menschen seien zu sehr damit beschäftigt gewesen, „ein Dach über dem Kopf“ und „eine warme Stube“ zu haben.
Auch in Friedrichshagen waren sowjetische Soldaten stationiert, teils mit, teils ohne Familien. Ihre Kinder – schließlich potentielle Spielgefährten – kamen hin und wieder aus ihrem kasernierten Bereich heraus. Engeren Kontakt mit ihnen gab es jedoch nicht. Sie hatten ihre eigenen Schulen und dergleichen. „Angst“ gegenüber den Vertretern der Besatzungsmacht bestand nicht. Klaus D. erzählt das Beispiel seiner Schwägerin, welche in Karlshorst wohnend dort über all die Jahre regelmäßig mit ihrer Familie auch im Areal der sowjetischen Streitkräfte bis in die späten Abendstunden hinein spazieren ging.
Klaus D. kommt noch einmal auf das Kriegsende zurück, dieses Mal in Friedrichshagen, am Spreetunnel: „Kurz vor Kriegsende hat irgend so ein Idiot eine Sprengladung angebracht, um die Russen aufzuhalten!“ Der Tunnel sei nach der Detonation vollgelaufen. Der Attentäter sei später von den Russen geholt worden, und er äußert sich über dessen weiteres Schicksal: „Den hat Deutschland nicht wiedergesehen.“
* Der Ausdruck „Halbjude“ - während der NS-Zeit gang und gäbe - ist ein rassistischer Ausdruck, denn nach jüdischem Selbstverständnis ist ein Mensch Jude, dessen Mutter Jüdin ist.